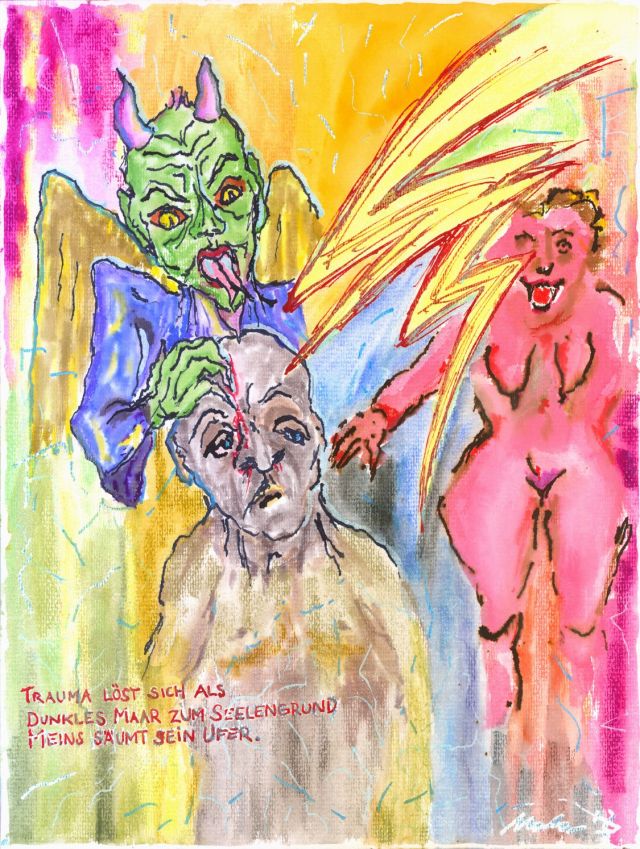
Eine Depersonalisationsstörung geht immer auch mit einer Realisationsstörung einher; denn je nachdem wie weit man sich in sich selbst entfremdet, entfremdet man sich auch in seiner Mit- und Umwelt. Man gerät sowohl zu sich selbst, als auch zur Wirklichkeit auf Distanz. Die Selbstwahrnehmung wird fragil und die Wirklichkeit entrückt, beides mag einmal gleichzeitig, aber auch einzeln mehr oder minder stark empfunden werden. Das Bild dieser seelischen Störung ist zudem von Person differenziert. Mal empfindet man den eigenen Körper als fremd, mal erscheint einem das eigene Spiegelbild als unwirklich. Mal scheint man nicht direkt zu agieren, sondern über eine Funktion in sich, oder man ist so stark dissoziiert, dass einem das eigene Handeln wie das eines Fremden vorkommt.
Meine Depersonalisation war mir von Kindheit ein selbstverständlicher Seinszustand. Es gab in mir zwei Selbstverständnisse: einmal meins und ein andermal seins. Es war so offensichtlich, dass ich auch von Personen, mit denen ich agierte gelegentlich darauf angesprochen wurde. Und ja, ich litt auch daran; und ja, es war mir selbst als Einschränkung meiner Erlebnisfähigkeit und Selbstwahrnehmung bewusst; denn ich schloss mich dadurch zu häufig von mir selbst aus, indem ich mich verbarg und nach außen oft unnahbar erschien. Ich lebe in splendid Isolation bemerkte dazu mal eine Bekannte. Gleichzeitig lebte ich mich selbst oft auch aus zweiter Hand, indem ich die Bilder, die andere von mir hatten annahm und nachlebte, um keine Sanktionen erdulden zu müssen. Erst 2011 mit Beginn meiner Traumatherapie benannte ich diese seelische Einschränkung und formulierte als Therapieziel meinen Wunsch: „Ich möchte komplett werden.“
Ich denke, in den letzten drei Therapiestunden des vergangenen Jahres wuchs ich wieder etwas zusammen oder zu mir, je nachdem aus welcher Perspektive ich hierbei auf mich selbst blicke. Das zeigt, die Störung ist sowohl noch virulent, als auch am schwinden. – Nachstehend die Aufzeichnung aus meinem Therapietagebuch über diese letzten Schritte.
11. November 2024
Zu Beginn eine kurze Reflexion zum Wahnsinn und der Lüge in der Welt, sprich ein kurzer Austausch zur aktuellen Nachrichtenlage. Dann die eine Frage zum Rest der Stunden: Sofern sie als Nachsorge abgerechnet werden, werden sie nicht in die Zweijahresfrist einbezogen, wodurch sich die Wartezeit verkürzt. Selbstverständlich wähle ich diese Option. Wer weiß, wie es mir nach der Therapie gehen wird. Jetzt stelle ich mir selbst eine gute Prognose, doch allein die Praxis wird es letztlich weisen.
Wir sprechen über den Therapieverlauf und M.R. meint, sie könnte es mit EMDR versuchen. Ich warf ein, dass mir hier mein Asperger in die Quere käme, da ich in der Fingerbewegung zwanghaft nach einem Muster suchen und mich so ausklinke würde. M.R. erwiderte, dass man auch mit tippen oder schnippen einen gleichen abschließenden Effekt erzielen könnte. Beides sagt mir zu, wobei mir das Fingerschnippen mehr zusagt.
Die anstehende Frage nach meiner Befindlichkeit beantworte ich durch drei Haiku, die ich auf dem Herweg im Zug verfasst hatte.
Orientierungslos
Find ich Richtung nur in mir
Novembernebel.
Vor rotbraunem Wald
Blüht Raps durchs Novembergrau
Erhellt mein Trauma.
Die Welt entleert sich
Meine Seele ebenso
Im Dunst des Traumas.
Ich rezitiere im Verlauf des Gesprächs wiederholt eins der Haiku, weil sie zur Beschreibung meiner Verfassung passen. Die PTBS ist in eine Novemberstimmung übergegangen; in keine Depression, sondern in die Milde des Diffusen. Nun, eine Folge des Erlittenen dürfte die Dysthymie sein, die ebenso zum Bordun meiner alltäglichen Befindlichkeit gehört. Die Hammerglasscheiben zeichnen nur ein milchgraues Wabern der Mindelheimer Bahnhofstraße. Es ist ein schönes Hineinschauen ins Unbestimmte, in meine Stimmung, in mein Seelenwehen.
Einmal mehr komme ich, was die allgemeine Stimmung nach und vor Wahlen angeht, auf den Irrsinn der Welt zu sprechen. Wie Pädophile sich an Kinder ranmachen, wie andere es auf Umwegen über das Queer-Narrativ versuchen, Kinder zu sexualisieren, und wie dazu wie einst in der Renaissance die Wissenschaft instrumentalisiert wird. Damals war es die Wissenschaft des Hexenglaubens, heute ist es die vom Ende der Bigeschlechtlichkeit. Bei aller Toleranz vergessen die Einfaltspinsel, dass zum Beispiel ein Lustmörder sein morden nicht beenden wird, solange er nicht im Knast ist, so wie ein pädophiler Kinderschänder solange weitermachen wird, bis er auf Dauer weggesperrt wird.
Angesichts dieser nachhaltigen Verwirrung des gesunden Menschenverstandes ist es für mich zwingend mir ein Umfeld einzurichten und zu bewahren, indem ich fernab von den Verwirrten ein heilsames Leben führen kann. Das heißt den Irrsinn als eine von mir nicht beeinflussbare Größe anzunehmen und mir so eine Basis für mein Überleben zu schaffen. Es sind Momente wie beim Besuch vom Sonntag bei Ida, der Stiefwahlmutter von Dagmar. Wir waren in der Wohnung, in der Erika 2001 verstarb; die Frau, die Dagmar und mich in die AA und damit in ein sauberes Leben begleitete. Es war jetzt, nachdem im Frühjahr Franzi ihr Ehemann gestorben war, der sich nach dem Tod von Erika mit Ida, seiner Schulfreundin, liiert hatte, das erste Mal, dass wir in beider Wohnung zu Gast waren, und es war mir eine beeindruckende Weile, denn es war mir fast, als umwehten mich ihrer beider Seelen. Jedenfalls waren es kostbare Momente, hier mit Ida über die beiden zu sprechen.
25. November 2024
Im Gegensatz zum letzten Mal scheint die Sonne durch die Hammerglasscheiben. Das Haiku, das ich vom Zug mitbrachte:
Sonne schmelzt den Schnee
Im Schatten bleibt er liegen
Gleich meinem Trauma.
Wir sprechen kurz über EMDR und andere Skills, um Traumafolgen zu reduzieren. M.R. fragt, was es den bräuchte, damit bei mir Traumata abschmelzen können. Sie meint, ich sollte mir verdeutlichen, dass das Trauma Erinnerungen an Ereignisse seien, die vor langem geschahen. Könnte ich es theoretisch unter diesem Gesichtspunkt sehen, könnten sie womöglich weiter an Wirkkraft verlieren. Ich erwidere, dass das einerseits einem Sowohl-als-Auch unterworfen sei; denn höchst selten nährt sich meine Depersonalisation aus konkreten Erinnerungen. Andererseits empfinde ich meine Depersonalisation auch nicht wie eine Dissoziation, bei der ich abwesend sei, das aber seien andere Zustände, die gottlob dank der Therapie (IRRT) nur noch selten auftreten. Vielmehr erlebe ich die Ferne zu mir in mir eher räumlich, indem eine Distanz in mir selbst zu meinerselbst entsteht. Diese Distanz lässt sich rasch provozieren, sobald ich Leistungen von mir vertreten müsste oder von anderen ob einer Leistung gelobt werden würde; dann träte rasch der Moment ein, dass Ich von Er spricht und ich zugleich empfinde, dass beide Parts nichts miteinander zu tun haben. Dabei entsteht eine emotionale Spaltung in mir, die meinerselbst Meinerselbst als ein anderes Selbst erscheinen lässt. Also nicht Ich erlebe mich gespalten, sondern Meins erlebt zwei Meins, was gleichwohl keine zwei Personen sind, sondern eben die Empfindung eines diskompletten Selbstverständnisses.
Die Metapher eines Fächers wird zum Versuch, dieses Selbstverständnis zu umschreiben. Ein offener Fächer läuft immer im radialen Dorn der Verbindungsniete zusammen, in der die einzelnen Streben und Stoffkeile zueinander fest doch in sich beweglich verbunden sind. Das macht mich aus, gleichzeitig macht mich aus, dass ganze Partien der Keile löchrig oder zerrissen sind. Oder eine Fächerbemalung zeigt zwei Personen – ich würde es eher Zustände nennen -, die einerseits getrennt und andererseits verbunden sind. Es sind freilich keine zwei Personen, sondern in ihrer abgestimmten Bewegung zwei Situationen, die lediglich zwei Momente einer übergeordneten Situation sind. Für den Moment befriedigt diese Skizze mein Bemühen gelebte Depersonalisation zu skizzieren. Im Nachhinein muss ich an die Parsifalsage von Eschenbach denken, die ich achtjährig im Kinderheim gelesen hatte. Mit der Figur des reinen Tor hatte ich mich damals wohl identifiziert, denn als ein anderer unter vielen verstand ich mich wohl fortan und konnte so überleben. Das Buch blieb mir als ziemlich zerlesen in Erinnerung; es musste wohl einige Kinder in seinen Bann gezogen haben.
Dem reinen Tor, das notwendigerweise vertrauensselige Kind, das ich wahr, steht mit meiner Frau Dagmar, der Kaspar Hauser gegenüber, der sich verbergende allen misstrauenden Findel oder Esposito (Ausgesetzte) gegenüber. Zwei kindliche Reaktionen oder Lebensentwürfe auf schwere traumatische, ja persönlichkeitsvernichtende Drangsalierung: Einerseits die Diskomplettierung einer Person durch Depersonalisation und andererseits die Fragmentierung einer Person in mehrere Persönlichkeitsanteile, wie eben bei Dagmar, die unter fünf Aspekten eben jenen Kaspar in sich birgt, um überleben zu können.
Ein anderes Bild, meine erlebte Depersonalisation zu umschreiben, liegt einmal mehr in der Schilderung, wie ich auf einer Ebene offensichtlich emotional auf einen Film reagiere, indem es (vermutich Er) aus mir weint, während der Betrachter (wohl Ich) als kritischer Zuschauer, um das dramaturgische Handwerk wissend, vom cineastischen Geschehen unberührt bleibt. Jedenfalls erstaunt mich dieserart Depersonalisation immer wieder, da ich die beiden Betrachter nicht einen kann.
Zwischendurch ein Abriss auf den Vater, der selbst keine unproblematisch Kindheit und Entwicklung hatte. Seine Störung oft in cholerischen Anfällen auslebte, die für uns Kinder durchaus gefährlich waren. Nur über ihn erkläre ich mir nichts und noch weniger meinerselbst. Er war eine kaputte Persönlichkeit von Angst durchdrungen, tat aber alles, um das erfolgreich zu kaschieren. Er war ein Kinderschänder, Großmaul, Lügner, Kinderschläger, Alkoholiker, Faulpelz und Blender.
Doch wieder zurück zu meinerselbst (der Begriff umschreibt mich meines Erachtens präziser als alle anderen Pronomen), diesmal bleibt die Selbsterfassung meinerselbst im Fokus. Eine Frage zwischendurch: „Wer macht ich aus? „Er“ oder „Ich“?“ Sie unterließ zwar M.R., doch sie begleitet mich, wenn ich mich beispielsweise frage, wer denn da weint, wenn ich beim Film weine. Ich weiß es jedenfalls nicht, sonst würde ich mich nicht fragen. Jedenfalls begegnet es mir spätestens dann, wenn mir bei einem Film die Tränen laufen und ich nicht nachempfinden kann, was in mir dabei so gerührt ist.
Dafür konnte ich in der Woche nach der Stunde ein Phänomen erhellen, das mir als solches gar nicht aufgefallen war – nämlich dass es mich und nicht nur Freaks betrifft. Es belebte sich erneut, als ich nach meiner zweiten Raucherphase in den 90er Jahren mit dem Rauchen aufhören wollte. Die Rauchentzüge waren heftig, allerdings machten sie mir wenig aus, vielmehr begann ich, das Gefühl während des Rauchentzugs überdreht und hoch oben zu sein, so zu schätzen, dass ich nach der Entwöhnungsphase, wieder bewusst zu rauchen begann, um alsbald erneut die „Vibrations“ eines Rauchentzuges zu durchleben. Ich erzählte später dann dieses Verhalten als Schnurre, wenn Dagmar anderen von ihren grauenhaften Rauchentzügen berichtete. Als ich das jüngst wieder tat, wurde mir in Erinnerung an die letzte Stunde deutlich, dass dies eigentlich ein SVV gewesen war, ein Versuch mich selbst zu spüren; wo andere sich ritzten, entzog ich mich vom Nikotin.
Zum Schluss eine Besinnung auf den Raum. Er ist von der Wintersonne durch das Hammerglas in ganz eigener Weise erhellt. Meine Befindlichkeit im Augenblick erfassen, da sein, das Gewesene als Gewesenes abweisen. Es ist vorbei. Ja, ich weiß, dass es vorbei und gleichwohl in den Narben und Seelenschmerzen gegenwärtig ist. Eine Gegenwärtigkeit, der ich nicht entfliehen darf, weil nicht entweichen kann. Ich wiederhole die Präsenzübungen; rücke meinen Leib ins Hier und Jetzt; entspanne; finde ein wenig zu mir. Wähle mir als abschließendes Bild Parsifal, wie er den Gral findet und von seiner Aura berührt wird. Ein schönes Bild, sehr versöhnlich mit mir und meinem Schmerz, die Keratose an den Händen zeigt, dass die Stunde wieder mal ein harter Weg gewesen war. Die Knöchel sind gerötet, aufgekratzt, der Zeigefinger wund. Doch für den Moment bin ich in Ruhe und Licht.
9. Dezember 2024
Fahrt zur Therapie
Zwei Teddys zur Begleitung
Stärken mein Gemüt.
Ich verfasse diesen Bericht eine Woche nach der Therapiesitzung, mal sehen, was mir noch in Erinnerung ist. Die emotionalen Feinheiten meiner Stimmung sind jedenfalls schon etwas verblasst. Ich empfinde noch die Spannung, womöglich einen Schritt vorangekommen zu sein; ein wenig Unmut über die Einwände, dass das Trauma eigentlich längst Geschichte sei; als auch die Freude an einigen Metaphern, die die Wahrnehmung meiner Depersonalisation treffend skizzieren und mir somit im Verständnis meinerselbst weiteren Grund vermitteln. Gleichzeitig wird mein Blick auf die Depersonalisationsstörung präziser und das Ausmaß der Beschädigung differenzierter.
Es geht um Lösungsstrategien, das Geschehene so einzuordnen, dass es mich mit seinem Nachhall weniger bedrücken kann; also den Wald trotz lauter Bäumen zu erkennen und zu sehen. Ich fühle mich an einfältige Weisheiten erinnert, wie wenn alle Menschen gleichzeitig beten, werde das Paradies augenblicklich wahr. Eine Metapher, von der ich einst als Kind hörte und die ich darob nicht verstand, weil das Ziel nicht schon längst Wirklichkeit geworden war; denn wer möchte nicht im Paradies leben.
Es ging um Loslassen, nicht im Sinne von vergessen – was eh nicht zu vergessen ist -, sondern nicht mehr daran zu leiden. Dabei hatte ich den Eindruck schon lange nicht mehr, dass ich an meiner Geschichte leiden würde. Ich leide auch nicht daran, allenfalls nerven mich angetriggerte Stimmungen und notwendiges Vermeidungsverhalten. Ja, womöglich leide ich auch darunter in Form anhaltender Dysthymie und spontaner Panikattacken. Jedenfalls hat M.R. den Eindruck ich würde nicht loslassen können. Ein Moment, den ich nicht verstehe.
Es gab verschiedene Lebensphasen posttraumatischer Zustände und ihrer Bewältigung. Einmal die rund zwei Jahrzehnte währende aktive Suchterkrankung von elf bis dreißig; danach rund drei Jahrzehnte traumatischer Folgestörungen, in denen ich immer wieder Grenzen auslotend versuchte, mich eben gegen diese Folgen zu wappnen; schließlich die durch die Namensänderung ausgelöste kPTBS mit teilweise suizidaler Befindlichkeit. Nun, wenn ich in diesen Weilen eins erlernte, dann war es wohl loslassen, wo ich loslassen konnte. Wobei es meist nicht um ein Loslassen an sich ging, sondern um einen Wandel oder ein Heilwerden meiner schwer beschädigten Seele. – Am derzeit letzten Komplex, der Depersonalisationsstörung, arbeiten wir. Das ist eine Baustelle und noch kein Moment, den ich loslassen kann, solange ich durch ihn eingeschränkt bin. Nein, ich denke nicht, dass da in den Grotten und Abgründen meiner Seele noch verborgene, drängende Trolle hausen, die ich gleich einem Basilisk mit seinem eigenen Spiegelbild schrecken und bannen müsste. Doch ebensowenig wie ich mein Dasein, meine Talente loslassen kann, kann ich auch meine Geschichte loslassen.
Nun denn, die Depersonalisationsstörung ist ja keine Folge aufkochender Maare, sondern war mein formuliertes Problem von der ersten Stunden an: „Ich möchte komplett werden“. Dass es ein mehr als zehnjähriger Weg bis dahin wird, bis dass ich die Depersonalisation angehen kann, war weder mir noch meinen Therapeuten klar. Nein, da wurde nichts unter den Teppich gekehrt. Um meinen seelischen Zustand zu skizzieren, wähle ich als Metapher tausend Peitschenhiebe, die der Delinquent über eine lange Zeit abtragen muss; denn man will ihn ja nicht totprügeln. Nach dem letzten Peitschenhieb bleibt ein geschundener, zernarbter Leib mit chronischem Wundschmerz. Ebenso empfinde ich meine verletzte Seele: schmerzend, trauernd, weinend, lachend, erleichtert, erwacht und dem Leben zugewandt. Nur eins empfinde ich nicht: mich komplett! Während ich das reflektiere, formuliere ich eine weitere Metapher für meinen augenblicklichen Seelenzustand und meine Vorstellung von Vollständigkeit: Der menschliche Blickwinkel beträgt 180°. Wenn ich meine Arme mit erhobenen Zeigefinger diametral zu beiden Seiten strecke – und ich mache das mit meiner Rede -, erahne ich bei einer Spannweite von 180° gerade noch beide Zeigefinger an der Grenze meines Blickfeldes. Das bedeutet übertragen, „Er“ und „Ich“ sind bei offenem Blick immer noch sichtbar. Erst wenn ich die Arme noch weiter nach hinten dehne, verschwinden sie. „Er“ und „Ich“ sind praktisch verschwunden, ich dagegen bleibe in der Mitte dieser Spanne. Und während ich dieses Bild demonstriere, erlebe ich in der Tat für den Augenblick, da der Blickwinkel überdehnt ist, für eine kurze Weile eine scheinbar selbstverständliche körperliche und seelische Ganzheit und Präsenz, ich bleibe zurück in der Mitte, dort wo ich bin. Das ist präsente Einheit Meinerselbst. Jedenfalls deute ich so die mich dabei erfassende überwältigende Empfindung. Es war ein Hauch von gleichzeitiger körperlicher und seelischer Selbstverständlichkeit. Das war bescheidenes und dennoch stolzes Ichsein und kein Zusammenspiel von „Er“ und „Ich“. – Es dürfte ein gutes Gefühl sein, komplett zu sein! Aus dieser Perspektive macht die Wahrnehmung von Hier und Jetzt nicht nur Sinn, sondern lebendig …
Auf dem Hinweg sah ich auf einer Wiese vor Buchloe einen Storch. Auf dem Rückweg staksten vor Türkheim gar zirka 50 Störche durch eine Wiese. Sie werden sich wohl in ihrem spanischen Winterquartiere gedacht haben, dass nun die vorweihnachtliche Warmzeit anbreche und es sich lohne, nochmal nach Norden zu fliegen.